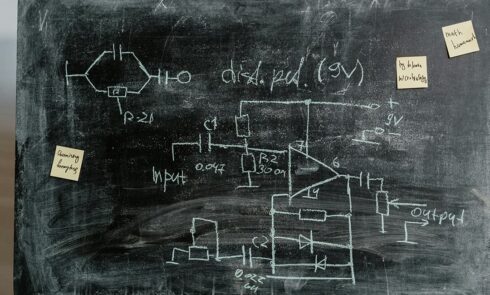Heute ist Kepler in der Wissenschaftsgeschichte vor allem für seine drei Planetengesetze bekannt, die er in ganz bestimmten Zusammenhängen und zu unterschiedlichen Zeiten aufgestellt hat. Obwohl es fraglich ist, ob er diese wissenschaftlichen Aussagen als „Gesetze“ verstanden hätte – und man kann sogar argumentieren, dass er den Begriff in einem anderen Sinne verwendete als wir heute -, scheint es klar zu sein, dass alle drei Gesetze (als sprachliche Konvention können wir den Begriff weiterhin verwenden) einige der Grundlagen von Keplers Philosophie andeuten: (a) Realismus, (b) Kausalität und (c) die geometrische Struktur des Kosmos.
Darüber hinaus ist anzumerken, dass der gemeinsame Nenner aller drei Gesetze Keplers Verteidigung des kopernikanischen Weltbildes ist, ein kosmologisches System, das er nicht verteidigen konnte, ohne es radikal zu reformieren. Es ist bemerkenswert, dass Kepler bereits zu Beginn seiner Karriere die Realität des kopernikanischen Weltbildes leidenschaftlich verteidigte, und zwar auf eine Art und Weise, die er – in Anlehnung an die Terminologie der aristotelischen Erkenntnistheorie – als „a priori“ bezeichnete.
Die ersten beiden Gesetze wurden ursprünglich in der AN veröffentlicht, obwohl bekannt ist, dass Kepler schon viel früher zu diesen Ergebnissen kam. Sein erstes Gesetz besagt, dass die Bahn eines Planeten eine Ellipse mit der Sonne in einem der Brennpunkte ist. Nach dem zweiten Gesetz deckt der Radiusvektor von der Sonne zum Planeten P gleiche Flächen ab. Folglich bewegt sich der Planet P im Perihel, wo er sich näher an der Sonne befindet, schneller und im Aphel, wo er weiter von der Sonne entfernt ist, langsamer. Im Einklang mit seinem dynamischen Ansatz fand Kepler zunächst das zweite Gesetz und dann, als weiteres Ergebnis der durch die angenommene Kraft erzeugten Wirkung, die elliptische Bahn der Planeten.
Die vielleicht bedeutendste Auswirkung der beiden Keplerschen Gesetze ist in ihren kosmologischen Implikationen zu sehen. Das erste Gesetz hebt das alte Axiom der kreisförmigen Umlaufbahnen der Planeten auf, ein Axiom, das nicht nur für die vorkopernikanische Astronomie und Kosmologie, sondern auch für Kopernikus selbst sowie für Tycho und Galilei noch relevant war. Das zweite Gesetz verstößt gegen ein weiteres Axiom der traditionellen Astronomie, demzufolge die Bewegung der Planeten gleichförmig ist. Die ptolemäische Tradition der Astronomie war sich dieser Schwierigkeit natürlich bewusst und verwendete ein besonders wirksames Mittel, um den „Schein“ der Beschleunigung zu wahren: die Äquante. Kopernikus hingegen bestand auf der Notwendigkeit des Axioms der gleichförmigen Bewegung im Kreis. Kopernikus verstand die Äquante des Ptolemäus als technisches Mittel, das auf der Verletzung dieses Axioms beruhte, während Kepler die Realität der Geschwindigkeitsänderungen der Planeten bestätigte und ihnen eine physikalische Erklärung gab. Nachdem er sich hartnäckig mit den etablierten Vorstellungen auseinandergesetzt hatte, die nicht nur in der Tradition vor ihm, sondern auch in seinem eigenen Denken enthalten waren, gab Kepler die kreisförmige Bahn der Planeten auf und leitete damit einen empirischeren Ansatz in der Kosmologie ein.
Das dritte Gesetz besagt, dass die Zeit, die ein Planet für einen Umlauf um die Sonne benötigt, umso länger ist, je weiter er entfernt ist oder je größer sein Bahnradius ist. So beträgt beispielsweise die Sternperiode des Saturn fast 30 Jahre, während Merkur weniger als 88 Tage für einen Umlauf um die Sonne benötigt. Für die Geschichte der Kosmologie ist es wichtig zu verdeutlichen, dass das dritte Gesetz dem Bestreben Keplers entspricht, das kopernikanische Weltbild systematisch darzustellen und zu verteidigen, demzufolge die Planeten nicht völlig unabhängig voneinander sind, sondern in einem harmonischen Weltsystem vereint sind.