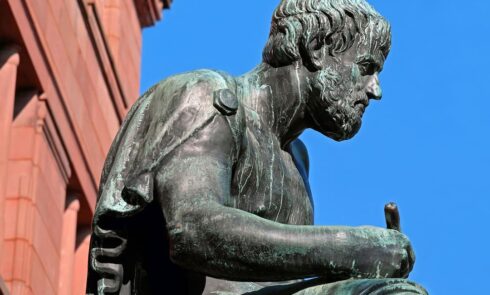Nach dem Tod von Rudolf II. ging Kepler nach Linz (Oberösterreich), wo er als Vermessungsmathematiker und als Lehrer arbeitete. Er sollte seinen Schülern sowohl mathematische als auch philosophische Fragen näher bringen und eine Karte von Oberösterreich erstellen. Diese Karte wurde jedoch nie fertig gestellt.
Keplers Tätigkeit in Linz war weniger anspruchsvoll als die in Prag, aber er konnte sich dort die Freiheit seines Geistes bewahren. Sein Leben in Linz war ruhiger als in Prag und bald nach seiner Ankunft in Oberösterreich heiratete er ein zweites Mal (seine erste Frau war bereits 1611 gestorben). Aus elf Kandidatinnen wählte er schließlich Susanna Reuttinger, die ihm später sieben Kinder gebar, von denen jedoch nur eines überlebte.
Obwohl sich Kepler in Linz sehr wohl fühlte, geriet er zu Beginn seines Aufenthaltes in einen Glaubenskonflikt: Als Kepler bestimmte Glaubensartikel des Predigers Daniel Hitzler kritisierte, verlangte Hitzler Keplers Unterschrift unter die Lehren der „Konkordienformel“. Aus Gewissensgründen konnte Kepler nicht zustimmen und zog stattdessen seine persönliche Freiheit vor.
Kepler setzte seine Forschungen in Linz mit Hilfe verschiedener prächtiger Bibliotheken fort. Einige aristokratische Gönner schützten ihn vor Konflikten, aber Kepler hatte keine Möglichkeit zum Gedankenaustausch mit anderen befreundeten Gelehrten.
Was die Theologie betrifft, so sind Keplers Studien über das Geburtsjahr Christi zu erwähnen. Er veröffentlichte seine Analysen zu diesem Thema in dem Werk „Bericht vom Geburtsjahr Christi“ im Jahr 1613. Kepler behauptete, dass Jesus Christus fünf Jahre vor dem üblichen Datum geboren wurde. Kepler hatte sich bereits 1606 mit diesem chronologischen Problem beschäftigt und griff damals seine damaligen Gedanken auf. (Übrigens ist der christliche Mönch Dionysius Exiguus [ca. 470 – ca. 540] als Initiator solcher Berechnungen bekannt.) Keplers Buch war eine Streitschrift gegen den Arzt und Astrologen Helisäus Röslin, der alle Gedanken Keplers über den „neuen Stern“, die Kometen und das Geburtsjahr Jesu Christi angezweifelt hatte. So verteidigte Kepler seinen Standpunkt in diesem Buch, in dem er sich als ausgezeichneter Historiker erwies.
In Linz beschäftigte sich Kepler mit mathematischen Problemen und veröffentlichte 1615 das Buch „Stereometria Doliorum Vinariorum“, nach dem später die „Keplersche Tonnenregel“ benannt wurde. Dieses Werk enthält neuartige Berechnungen des Volumens. Die neue Methode bestand darin, das Volumen von Weinfässern zu berechnen, indem man eine Messrute in sie eintauchte. Ein Jahr später folgte mit dem Werk „Auszug aus der uralten Meßkunst Archimedis“ eine wesentlich einfachere Version dieser Ideen. Die Absicht dieses Buches war es, die praktischen Anwendungen zu betonen. Außerdem befand sich am Ende des Buches ein Verzeichnis der Fachbegriffe, in dem Kepler die lateinischen Termini mit deutschen Übersetzungen versah.
Im Jahr 1615 wurde Keplers Mutter der Zauberei angeklagt. Er bemühte sich, sie zu verteidigen, und fünf Jahre später gelang es ihm schließlich, dass sie freigesprochen und freigelassen wurde. Doch ein Jahr später starb sie an den Folgen der Folter. Aufgrund dieser Ereignisse war Kepler nicht sehr motiviert, in Linz weiter wissenschaftlich zu arbeiten, dennoch begann er die Studien „Harmonices mundi“ zu schreiben, die als das tiefgründigste Werk Keplers angesehen werden können. Im Jahr 1619 beendete er diese fünf Bücher, die sich mit der Anwendung der Harmonielehre in der Musik, Astrologie, Geometrie und Astronomie beschäftigen. Was die Musik betrifft, so glaubte Kepler an eine musikalische Konsonanz als Hilfe für die Anordnung der Räume zwischen den Planeten entsprechend den Tonsorten. Im Zusammenhang mit dieser Theorie beschäftigte er sich mit der Frage, warum der Mensch bestimmte Intervalle als wohlklingend, andere aber als kakophonisch empfindet. Kepler glaubte, mit den Thesen dieses von platonisch-pythagoreischem Geist durchdrungenen und besonders von Proklos beeinflussten Werkes die Logik Gottes bei der Erschaffung der Welt verstanden zu haben. Dementsprechend war er in heller Aufregung.
Auch in den „Harmonices mundi“ wollte Kepler die Wunderlichkeit der göttlichen Schöpfung offenbaren. Doch in diesem Werk gibt es an manchen Stellen einen Gegensatz zwischen Keplers mystischem und seinem wissenschaftlichen Anspruch – zum Beispiel bei den Gezeiten. Hatte er früher die Gezeiten als Folge der Anziehungskraft des Mondes gesehen, so gibt er nun eine mystisch-poetische Antwort auf diese Frage, indem er auf den Atem des beeindruckten Körpers der Erde verweist. Es ehrt Kepler, dass er beide Wahrnehmungen hatte und dass es keinen Konflikt zwischen ihnen gab. Allerdings waren die „Harmonices mundi“ schwer zu lesen, so dass es keine Rückmeldung gab. Keplers Vorstellungen von einer universellen Harmonie bildeten einen Gegenpol zu den religiösen Konflikten und dem Schrecken des Dreißigjährigen Krieges. Deshalb setzte sich Kepler in seinen Briefen und in den Widmungen seiner Bücher leidenschaftlich für den Frieden ein.